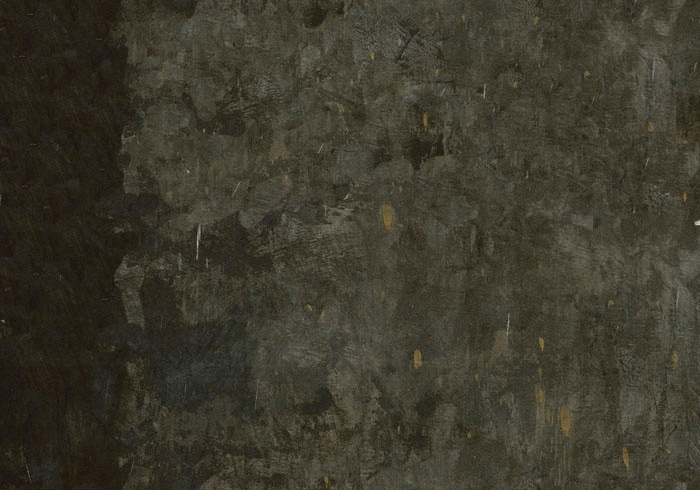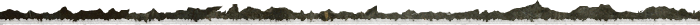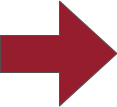Kritiken zu: „Hitlers Kindheit“
Die Überraschung des Abends ist die junge Schauspielerin Melanie Nawroth. Sie findet bewegende Haltungen für die verschiedenen Altersstufen der Hitler-Figur.
Welch eine Herausforderung für die kleinwüchsige, aber riesengroß spielende Melanie Nawroth in der Titelrolle. Sie hatte alles mit größtem Eifer im Griff, auch jene väterliche Übermacht, welche ihr Doppelerzeuger oftmals nur zu behaupten verstand. Toll.
Die Besetzung des Titelhelden mit der jungen Melanie Nawroth erweist sich als Glücksgriff. Wie ihr, vom Vater ertappt, der Pfefferkuchen aus der gestohlenen Keksdose im Munde stecken bleibt, wie sie für Momente der grausigen Realität entschwebt, indem sie hingebungsvoll die von ihr gemalten Phantasiegestalten beschreibt, wie sie sich schließlich mit angeklebtem Bart und ausgestrecktem Arm in eine Vision von welterschütternder Größe steigert, lässt manche Schauspielerische Unbeholfenheit im Umfeld vergessen.
(Frankfurter Rundschau 08.04.1998)
Kritiken zu: „Der Name“
Die berührendste Figur gelingt Melanie Nawroth als Schwester, die hinaus ins Leben will und nur bis zum nächsten Kiosk kommt. Sie kann noch träumen, flirten und hoffen, doch ihr Schicksal ist vorgegeben.
(WDR3 18.09.00)
Die burschikose Naivität von Melanie Nawroth als Schwester wirkt wie ein vergebliches Auflehnen gegen den Spuk, sein Leben nicht in den Griff zu bekommen.
(Rheinische Post 18.09.00)
Melanie Nawroth machte in der Rolle der Schwester der werdenden Mutter auf sich aufmerksam; die junge Nachwuchsschauspielerin hat Talent als Komikerin. Sie zog gekonnt die Beschränktheiten ihrer Altersgenossinnen durch den Kakao, die gern anderen die Schuld geben, wenn sie selbst versäumen, initiativ zu werden. Derartig präzise Beschreibungen der Wirklichkeit wirken interessanter als der Rückzug auf die symbolischen Tiefenschichten des minimalistischen Stücks.
(General-Anzeiger Bonn 21.09.00)
Kritiken zu: „Die drei Vögel“
Die Schauspieler gingen in ihren Rollen geradezu auf, wohl das Beste, was man über eine Inszenierung sagen kann. Besonders eindrucksvoll gelang die Vergewaltigungsszene - übrigens ohne jegliche Peinlichkeit - und das anschließende Entsetzen von Opfer wie Täter. Philomela scheint sogar mehr durch das zerbrochene Vertrauen innerhalb der Familie getroffen zu sein als durch den Akt selbst und malt sich die Folgen für sich und Tereus aus, so dass dieser sich aus Angst vor der Entdeckung auch noch zu dem nächsten grausamen Schritt gezwungen sieht. Melanie Nawroth und Michael Witte beschworen eine geradezu beängstigend dichte und tiefe Atmosphäre nach einem nicht wieder gut zumachenden Schritt. Auf schmalem Grat bewegt sich auch die Szene, wenn Procne und Philomela beschließen, Itys zu opfern, der als kindergroße Puppe auftritt. Der Mord an der Kindpuppe gelingt ebenfalls ohne peinliche Lächerlichkeit, da die Herleitung der Entscheidung straff, mit dem nötigen Ernst und vor allem der Dringlichkeit einer angemessenen Rache erfolgt. Noch ehe auch nur ein Zuschauer eine unfreiwillige Komik im Puppenmord entdecken konnte, war die Szene vorüber. Für die Schauspielerinnen Britta Hübel und Melanie Nawroth kam es bei dieser Szene auf jedes Wort und jede einzelne Bewegung an, und gerade durch ihre Sparsamkeit in Mimik und Gestik gelang die Szene überzeugend.
Nach seinem Gewaltakt gegen Philomela bieten die stummen Schreie von Melanie Nawroth einen der hoch expressiven darstellerischen Momente dieser Inszenierung.
(Offenbach Post 10.06.03)
Vor allem die Frauen überzeugen: Melanie Nawroth hat jener Philomela in einem großartigen Monolog schon vor der Rache zu ihrem Recht verholfen,so intensiv übersetzt sie die Scham, Wut und Trauer der Vergewaltigten in Fleisch und Wort.
(FAZ 10.06.03)
Die bewegendste Szene ist bezeichnender Weise jene,als Philomela schreien möchte und nichts mehr sagen kann.
(Darmstädter Echo 10.06.03)
Rauwald hat in Melanie Nawroth eine Philomela, die der jüngeren Schwester zuerst eine naive Unbekümmertheit gibt. Im stummen Part, nachdem Tereus sich an ihr vergangen hat, gelingt ihr die eindringliche Studie einer im eigenen Körper gefangenen und auf Rache sinnenden Frau.
(Süddeutsche Zeitung 14.06.03)
Kritiken zu: „Die Präsidentinnen“
Nawroths Mariedl ist ein großes Kind, dessen Kulleraugen unter der blonden Zopfperücke flink zwischen Erna und Grete hin - und herschauen. Manchmal erträgt Mariedl das Gekeife der beiden nicht: Dann zieht sie sich ihre Kapuze über den Kopf und setzt sich in den Kühlschrank.
(FAZ 26.01.04)
Es gibt ständig was zu erleben, und sei es bloß ein Blick aus den Augenwinkeln,mit denen Mariedl ihre Genossinnen auskundschaftet. Melanie Nawroth spielt das Küken in diesem Terzett, an dem Erna und Grete verschüttete mütterliche Gefühle austoben. Dieses Mariedl ist nicht das halbdebile Geschöpf,wie es in anderen Inszenierungen zu sehen war. Sie ringt um Anerkennung mit ihrem größten und wahrscheinlich einzigen Talent - der Reinigung verstopfter Toiletten. Wenn sie mit visionärer Hingabe ihr „die Mariedl macht‘s auch ohne“ juchzt, gibt sie ihrer Abortheiligen visionäre Größe. Das Publikum war hingerissen von diesen Schauspielerinnen. (Darmstädter Echo 26.01.04)
Kritiken zu: „Der Mensch,das Tier und die Tugend“
Farbe kommt in die Inszenierung auch durch die diversen skurril anmutenden Nebenfiguren, so vor allem Melanie Nawroth als kesser Filius Nono, ganz in den Machofußstapfen seines Vaters wandelnd.
Die Hosen-Träger bei Pirandello sind ausnahmslos vom Platzhirschwahn befallen, und Mouchtar-Samorai legt Wert darauf, das bis in die kleinste Nebenrolle hinein drastisch herauszuarbeiten.
So gehört Perella-Filius Nono (rotzfrech: Melanie Nawroth), der seine sanfte Mutter verachtet, den prügelnden Vater aber vergöttert und kopiert, ebenso zur verschworenen Chauvigemeinschaft wie die pubertierenden Lateinschüler und der Matrose, der sich über Grazia lustig macht.
(General-Anzeiger Bonn 12.12.04)